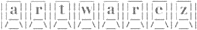Über die unmögliche Möglichkeit, das eigene Leben zu schreiben. Ein Gespräch zwischen Ute Vorkoeper und Cornelia Sollfrank
18. September 2005
[Cornelia Sollfrank]
Wir unterhalten uns über Autobiographie, und wenn unser Gespräch aufgeschrieben und gedruckt ist, werden wir schon wieder andere sein. Aber das Gespräch wird Teil unseres Lebens sein und wir können darauf zurück blicken, uns darin erinnern und darüber in unserer Autobiografie schreiben.
[Ute Vorkoeper]
Wir werden andere sein und doch auch nicht. Erschreckender als Veränderungen finde ich, wie wenig anders man im Rückblick ist und wie oft man das Gleiche wiederholt. Das Leben, der Lebensprozess steht klar gegen die Vorstellung der Autobiographie, d.h. also die doppelte Vorstellung, dass sich das Leben als Geschichte schreibt und man selbst dieses Leben schreibt. Ich kann mir nicht vorstellen, außer vielleicht in radikaler Konzeptkunst, die sich auf die reine Idee zurückzieht (und selbst da ist es fraglich), dass etwas gedacht, geschrieben oder als Kunst gemacht werden kann, das nicht durchkreuzt wird vom Leben, d.h. von Kontingenzen, Wiederholungen, Zusammenbrüchen, Zuneigungen und anderen Emotionen.
C: Da sind wir schon an dem Punkt angelangt, der mich am meisten beschäftigt, nämlich den - meinen - Versuch als Künstlerin, die eigene Person, die eigene Vergangenheit, das eigene Gefühlsleben aus der Kunst, die ich mache, herauszuhalten.
Du erwähnst die Konzeptkunst als Beispiel dafür. Ich habe meine eigene Kunst sehr lange verstanden als etwas, das ich konstruiere, mir ausdenke, Ideen und Konzepte, die ich entwickle, die aber nicht etwas von mir ausdrücken sollten. Alles (angeblich) Authentische lehn(t)e ich von vorne herein ab. Künstler, die sich damit abmühen, ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen, sind mir ein Greuel.
U: Der Antagonismus der Positionen ist das Problem: Gefühl vs. Konzept und Objektivität. Soweit ich deine Arbeit beurteilen kann und dich kenne, denke ich, dass deine Abwehr gegen Persönliches und Privates in der Kunst etwas damit zu tun hat, die altbackene Kategorie Frauenkunst ebenso wie die Nischenposition der Gendertante abzuwehren, die im Kunstbetrieb bedrohlich nahe rücken, wenn man, wie du, mit weiblichen und männlichen Rollenklischees spielt. Gegen unser Wissen und Denken wirkt untergründig außerdem immer noch das alte männliche Vorurteil weiter, dass Frau "subjektiv Biografisches" bastelt und Mann etwas "Objektives" schafft. Die Sorge, dass das eigene Leben in die Kunst hineinspielt, ist damit vorwiegend darin begründet, dass man Angst hat, missverstanden oder in eine bestimmte Ecke gestellt zu werden, die durch die Polarisierungen wie subjektiv/objektiv, öffentlich/privat, Innenleben/Außenleben charakterisiert wird. Was nach wie vor eigentlich hinter diesen Zuordnungen steht, ist die Idee, dass ein Mensch entweder als Programm auf die Welt kommt, in dem alles als Potenz (sic) angelegt ist, was sich dann im Laufe seines Lebens entfalten wird, oder eben als pure Möglichkeit, die sich voluntaristisch selbst erschafft. Das Ergebnis ist in beiden Fällen dasselbe, wenn man etwas mehr Willens- und Wahlfreiheit behaupten möchte, das von ihm entfaltet werden kann. Und am Ende schaut er zufrieden zurück und sagt, aha, da war mein Anfang, da ist mein Hauptteil und da ist mein Schluss. Und dann hätten wir eine runde Auto-Biographie. Alles hat sich bestens entfaltet und erfüllt, oder ist bestens entwickelt worden, wo auch immer es angelegt war, dieses Programm oder die Möglichkeit, in den Genen, der Seele, im Magen. Wo genau diese "Substanz" sitzt, wird ja in der Regel nicht näher ausgeführt.
C: Du meinst damit, Frauen haben Angst, als emotional betrachtet - und wahrscheinlich abgewertet - zu werden, wenn sie Gefühle ausdrücken, während bei Männern das Ausdrücken von Gefühlen als schöpferisch gilt, als genau das, was sie zu Genies macht!?
U: Bei Männern wird Expression nicht als emotional oder subjektiv verstanden, sondern als Befreiung oder Freiheit des Ausdrucks. Das ist ein wichtiger Unterschied. Auch wirkt das biologistische schöpferische Programm für Frauen nach: "Frau kriegt und erzieht Kinder". Deshalb lehnen viele Akademikerinnen Kinder so lange ab, sie haben Angst, damit das Programm zu erfüllen. Zugleich aber ist in den öffentlichen frauenpolitischen Diskursen und im Gender Mainstreaming immer von "gebrochenen Biografien" die Rede, wenn es um Frauen geht. Gemeint sind die sog. Ausfallzeiten und Karriereknicks wegen der Kinder. Das sind dann "faktische" Gebrochenheiten, die jedoch kaum für Karrierefrauen gelten. Aber ich würde die Gebrochenheit der Biographie sowieso nicht an Kinder binden, sondern für alle - Männer wie Frauen - als gegeben ansehen.
C: Ja, allerdings. Ich denke, dass die Vorstellung eines einheitlichen Selbst langsam verschwindet.
U: Das kann es nur als Fiktion geben. Und versucht man diese Fiktion als eigenes Leben zu leben, d.h. alles imaginär zur Einheit zu fügen, droht ständig die Gefahr, dass das konstruierte Ganze kollabiert. Entweder wird man dann neurotisch oder psychotisch. Allerdings gibt es auch das oft als Erlösung gepriesene radikal offene und fluide Selbst nicht. Diese Vorstellung ist der ebenfalls fiktive Ableger der alten Ganzheitsfiktion, weil sie den diesem inhärenten Aktionismus und Voluntarismus übernimmt und ins Gegenteil verkehrt. Mit "Gebrochenheit" meine ich den Konflikt zwischen Passivität und Aktivität, genauer, die Annahme einer grundlegenden Passivität des Ich gegenüber dem Unbestimmten und Unbestimmbaren des eigenen Lebens. Als gebrochenes erkennt das Ich an, dass sich das eigene Leben der willentlichen Gestaltung und Selbstherrschaft entzieht, sich stattdessen immer in Relation auf andere, anderes ereignet. Paradoxer Weise ist es ausgerechnet diese Passivität, die die Verpflichtung zur Handlung in der Welt gibt.
C: Dann könnte man das Ausleben und Zeigen von Gebrochenheit doch auch als einen Ausdruck von Freiheit interpretieren, der Freiheit, sich nicht dem Zwang der einen Geschichte unterzuordnen. Eine Freiheit, die sich Frauen offensichtlich leichter nehmen konnten als Männer.
U: Genau. Ich würde es als Freiheit interpretieren, aber...
C: Aber trotz der Erkenntnis der zwangsläufigen Gebrochenheit von Leben bzw. der Einsicht, dass Zuordnungen wie "diskontinuierlich" oder "bruckstückhaft" bezüglich der Biografien von Frauen ein Ausdruck geschlechtsspezifischer Abwertung sind, wird dieser Anspruch der Ungebrochenheit und Stimmigkeit einer Biographie permanent an einen herangetragen. Die Kunst und das Leben müssen zusammenpassen, sich fügen. Die Kunst muss aus dem Leben erklärbar sein.
Das zu überprüfen bzw. herzustellen ist doch eine der wesentlichen Tätigkeitsgebiete der Kunstgeschichte.
U: Auch hier wieder die alten Entgegensetzungen. Es hat damit zu tun, dass es für zeitgenössische Kunst keine äußere Legitimation gibt. Man hat keine Instanzen, weder Könige noch Kirche, die das Werk, die Kunst beglaubigen. Deshalb baut man auf innere Werte. Und die plausibelste Legitimation, die man finden (erfinden) kann, liegt in der Authentizität und der Kohärenz eines gelebten Lebens. Das wird dann als objektiv so behauptet.
C: Und diese Kohärenz oder mangelnde Kohärenz wird bei Frauen und Männern anders gewertet.
U: Wie du schon sagtest: Das Gebrochene wird als Bruchstückhaftes und jeder Bezug auf persönliche Erfahrungen als subjektivistisch abgewertet. Allerdings ist es für mich einerseits ein Freiheitsfeld und andererseits ein wichtiger Punkt, über den ich künstlerische Qualität beurteile, nämlich wie sich die Gebrochenheit des Lebens und damit auch die eines/einer Künstlers/Künstlerin mitteilt. Und selbst du hast dich bei deinen Arbeiten nie raushalten können, obwohl du dich darum bemüht hast, indem du unterschiedliche Identitäten immer explizit als "Rollen" gespielt hast. Aber über die Wahl der Rollen, über die Art der Performances bist du immer drinnen gewesen. Das ist genau das Interessante, darin liegt für mich Qualität.
C: Das ist ein Aspekt, dass man sich selbst nie wirklich raushalten kann; aber was ich fast noch spannender finde, ist der Wunsch von Künstlern, Künstlerinnen und überhaupt Autor/- innen das zu tun. Selbst nicht in Erscheinung treten zu wollen. Und dieser Wunsch, sich raus zu halten ist bzw. hat doch paradoxerweise etwas ganz stark Autobiographisches. Ich lese das als einen Hinweis auf das Selbst durch die Abwesenheit desselben.
U: Hier an der Wand deines Arbeitszimmers hängt das Plakat der letzten Ausstellung von Elaine Sturtevant in Frankfurt, "The Brutal Truth". Sie ist radikale Konzeptkünstlerin, wenn sie Kunstwerke, die es bereits gibt, wiederholt, noch einmal macht. Die kopierten Werke alleine sind furchtbar langweilig. Interessant ist das Gesamtsetting: Eine Frau wiederholt Kunst von Männern und rund um das entsteht ein eigener Diskurs - und mit dem eine Biographie. Und das, obwohl sich die Arbeit nur in Verdoppelung und Appropriation abspielt.
C: Das Plakat gibt ja auch einen deutlichen Hinweis auf dieses Zusammentreffen oder Zusammenwirken von Person und Konzept.
U: Ja. Sturtevant ist nackt (man sieht sie nackt, von links nach rechts laufend, vor der von ihr in Öl auf Leinwand wiederholten Flagge von Jasper Jones). Und diese Nacktheit ist erschreckend. Sturtevant hat sich zum Prototyp der Frau gemacht, die sich selbst vollkommen raus nimmt und das alte Programm der Frau als Epigonin erfüllt. Deshalb ist sie vollkommen nackt. Oder sie bleibt völlig nackt. Wichtig ist, dass sie um diese Nacktheit weiß und sie uns vorführt. Über sich selbst sagt sie nichts.
C: Ihr Wunsch abwesend zu bleiben, zeigt mehr von ihr - und deshalb ist sie nackt - als viele Künstler/-innen, die sich ganz "wahrhaftig" einbringen, aber letztendlich nichts weiter als eine publikumswirksame Performance hinlegen.
Das Phänomen bei Sturtevant ist, dass es nur auf den ersten Blick klar ist, was sie macht: Sie macht nach, sie macht nochmal. Je genauer man aber hinsieht, umso undeutlicher und vor allem auch widersprüchlicher wird ihre Arbeit und ihre Verwicklung in ihre Arbeit. Und sie trägt nicht zuletzt selbst dazu bei, indem sie sich vollkommen widersprüchlich äußert zu sich und ihrer Arbeit. In gewisser Weise betreibt sie genau das Gegenteil einer Glättung ihres Lebens im Sinne einer Geschichtsschreibung. Sie erzählt immer wieder Dinge, die eben genau nicht zusammen passen und keinen Sinn ergeben, bzw. füllt die Lücken, die sich auftun jedes Mal mit anderen Erklärungen und anderen Geschichten. Und die Wiederholungen, die sie als Kunst betreibt, die Werke, die sie herstellt, sind eigentlich nur ein Vehikel, um auf sie selbst zurückzukommen, auf die, die sich scheinbar raus hält. Man fragt sich zwangsläufig, wo ist die und wer ist die, die so offensichtlich abwesend sein will. So lese ich ihre Arbeit, und dieser Mechanismus spricht mich natürlich sehr an, weil er mich an meine eigene Arbeit erinnert.
Ihre Retrospektive im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt zu sehen war ein echtes Erlebnis. Ich glaube, ich habe noch nie Kunst erlebt, die so wenig in einer Ausstellung funktioniert wie ihre. Ich fühlte mich wie in einem Kaufhaus. Ich stand da und wunderte mich über alles, nicht zuletzt über mich selbst. Ich glaubte wirklich eine Abwesenheit zu spüren.
U: Es ist ja ein großes Missverständnis anzunehmen, dass man sich nackt selbst zeigt, bzw. nackt mehr von sich zeigt als wenn einer in Verkleidung steckt. Verkleidung und laute Performances sind viel entblößender als Nacktheit an sich. Die pure Nacktheit ist eher ein Nullpunkt, ein Nichts, eine Abwesenheit, wie du sagst. Allerdings fehlt mir da, bleibt es dabei, der Bezug auf etwas Transzendentes und auf die unbeantwortbare Frage, was richtiges, falsches, oder was überhaupt menschliches Leben ist. Pure Körperlichkeit steht auch für Nichtleben. Das ist der andere Gegenpol zum Biographischen: Die Vorstellung vom Menschen als reine Biomasse mit Vernunftbegabung, die zur Versorgung verwendet wird und sich ansonsten nach biologischen Gesetzen richtet, ist ebenfalls radikal unbiographisch.
C: Damit gehen die wohl menschlichsten Dimensionen des Menschen, das Geschichten erzählen und politisches Wesen sein, baden...
U: Und man kommt zum ambivalenten Kern des Ganzen: Kohärente Geschichte ist pure Fiktion, aber ohne Geschichte sind wir im Leben tot.
C: Du hast dich ja sehr intensiv mit der Kunst von Anna Oppermann auseinandergesetzt. Soweit ich weiß, hast du eine biographische Interpretation ihrer Arbeit immer abgelehnt. Was steckt denn da genau dahinter?
U: Hauptsächlich ging es mir darum, das Missverständnis abzuwehren, dass alle Ensembles von Anna Selbstbildnisse seien. Daraus wurde nämlich vielfach öffentlich geschlussfolgert, dass sie gestört sei, psychotisch, egoman, einfach total durchgedreht. Man hat die Einzelteile eines Ensembles dann als auseinander driftende Partikel gedeutet, sogar als Zeugnisse für Partialidentitäten. Damit kam man zum Schluss: Hier ist ein zersplittertes Subjekt, das unfähig ist, Schlüsse zu ziehen und Zusammenhänge herzustellen. Diese Art der biographischen Deutung als pathologischen Fall habe ich abgewehrt.
C: Obwohl ich Anna nicht kannte, habe ich aber den Eindruck, dass sie vielleicht nicht unbedingt eine psychotische, aber eine isolierte und vielleicht fragmentierte Person war.
U: Sicher, und das hätte sie selbst auch nie geleugnet. Das gilt schließlich mehr oder weniger für alle. Und gerade Momente der Isolation und Einsamkeit hatten großen Anteil daran, dass sie zu dieser Form fand. Aber es war eben genau anders herum. Es ging nicht um den Ausdruck der Fragmentierung, sondern um den Versuch der Kommunikation, den Versuch, disparate Dinge in den Dialog zu bringen und mit anderen in einen Dialog zu treten.
C: Aber bei Anna geht es dir doch nicht nur darum, dass sie nicht pathologisiert wird?
U: Das ist der eine Aspekt. Darüber hinaus ist mir wichtig, nicht den Blick darauf zu verstellen, dass dort Inhalte, zentrale Konflikte und Fragen in einer bislang unbekannten Weise verhandelt werden: Das geht von Fragen zum Frausein zu Außenseitersein über Problemlösungsstrategien bis zu Liebe und Pathos.
C: Aber gab es nicht auch die andere Anna Oppermann, die eine auffällige Maske trug in der Öffentlichkeit? Und was spricht dagegen, genau das in eine Rezeption oder Werkinterpretation einzubeziehen?
U: Das öffentliche Bild hat mich früher nicht so beschäftigt, vielleicht war mir das zu nah, weil ich sie anders kannte. Aber es ist ein Fakt, dass sie sich nach außen über Jahre als Bild inszeniert hat, als Bild, das sie selbst kontrollieren konnte und wollte mit goldenen Wimpern, Turban und auffälligen Kleidern. Unnahbar. Vielleicht brauchte sie sich öffentlich als Bild und unnahbar, um mit ihren Gebrochenheiten, mit dem was nicht funktionierte und nicht aufging, allem, was nicht kohärent war und was in ihren Arbeiten zur Ansicht kommt, umgehen zu können. Auf jeden Fall steht dieses Selbstbild im krassen Gegensatz zu den Ensembles. Die lassen es nicht zu, dass man sie in einem Bild zu fassen kriegt, stattdessen entstehen immer neue Knoten- und Entscheidungspunkte. Aber was dabei eben nicht entsteht, ist ein kohärentes Selbstbild.
C: An dieser Stelle könnte man auch eine Gemeinsamkeit der beiden so unterschiedlichen Künstlerinnen Sturtevant und Anna Oppermann ausmachen, nämlich das Fehlen eines substantiellen Selbst.
U: Anna Oppermann hat dafür ein gutes Bild gefunden. Sie sitzt in der Ecke ihres Ensembles "Anders sein" und hat ihre langen Haare vor das Gesicht gekämmt. Im Zentrum des Ensembles sieht man etwas, das sichtbar verborgen ist, das weder selber sieht noch von anderen angeschaut werden kann. Es ist Metapher für die Verborgenheit des Selbst in der Sichtbarkeit wie natürlich auch ein wohlgemeinter Hinweis, die Ensembles nicht auf das Subjekt Künstlerin bezogen zu verstehen. Es sprechen so viele Stimmen in einem Ensemble, es sind so viele Perspektiven und Einstellungen durchgespielt. Anna hat die Bewegung ihrer Arbeit deshalb auch immer "vom Privaten zum Allgemeinen" beschrieben, von der Nähe zur Distanz. Sturtevant geht genau von der anderen Seite los, sie startet mit allgemein Verfügbarem. Alles sieht so klar und einfach und offen aus und plötzlich wird es überlagert durch das Gesprochene, durch unendlich viele variierende Reden, die mit zum Werk gehören. Zug um Zug wird die Künstlerin rätselhafter und es entsteht ein ungreifbares Selbstbild.
C: Ich habe in Bezug auf das Autobiographie-Thema zu Blogs (Weblogs) recherchiert. Das sind Online Publishing Systeme, mit denen es sehr einfach ist, Webseiten zu publizieren. Neue Einträge stehen an oberster Stelle, ältere folgen in umgekehrt chronologischer Reihenfolge. Neben Fach- und Themen-Blogs geht es häufig einfach um persönliche Selbstdarstellung. Das Format erlaubt große Flexibilität und Spontaneität und eignet sich hervorragend dafür, eine sehr subjektive Perspektive wieder zu geben. Häufig wird einfach nur kommentiert, was man gesehen oder gelesen hat und über dieses Kommentieren zeichnet sich über einen Zeitraum dann ein immer deutlicheres Bild des/der Kommentierenden.
Nun gibt es einige wenige Blogs über Kunst, und es gibt eine Menge Blogs von Künstlern, die aber meist eine ähnliche Qualität besitzen wie frühe Homepages von Künstlern, nämlich schlecht und langweilig sind und in keiner Weise das Medium ausreizen. Das hat mich verblüfft, denn Blogs sind auch eine neue ära von Tagebüchern und würden sich aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften hervorragend eignen, eine Geschichte zu schreiben, die eigene Geschichte zu schreiben, ohne dass es wirklich eine kohärente Geschichte sein müsste.
U: Wir sind wahrscheinlich noch zu sehr geprägt von der Vorstellung, eine Autobiographie abliefern zu müssen mit Anfang, Hauptteil, Schluss. Darüber sprachen wir ja zu Beginn. Schließlich steht als Motiv hinter Kunstmachen und Künstlersein nach wie vor etwas von dem Wunsch, das eigene Leben zu verlängern, zu überleben.
C: Mag sein, aber ich finde es gibt sehr unterschiedliche Arten, diese Geschichte zu schreiben. Und ich finde eine subtile Weise, die über kleine Setzungen funktioniert oder über ein Sich-Entziehen interessanter als das brachiale Geklotze mit dem Persönlichen und Privaten. Dabei denke ich natürlich an Phänomene wie die Young British Artists; das Comeback des Authentischen.
U: Ich finde es problematisch, die ganze Young British Art gleich zu machen. Aber auch bei den Künstler/-innen, die ich schätze, ist es in der Tat wieder mal die Rezeption, die über Begriffe wie Authentizität ihren Kick oder ihren Brechreiz kriegt. Damit soll alles einzigartig und spektakulär werden. Dabei holen sich die Sammler und Kuratoren nur Ersatz für die fehlenden eigenen Geschichten. Man ist bemüht, ein allgemein beobachtbares Manko an Geschichten und Geschichtlichkeit auszugleichen. Aber das verzerrt den Blick und lässt wieder fixe Bilder entstehen. So entgeht dasjenige, was gebrochen ist, was sich nicht fügt.
Schließlich aber brauchen wir alle Geschichten, um die kurze Zeitspanne zwischen Geburt und Tod zu füllen und zu einem Leben zu dehnen. Und wir brauchen etwas davor, wie wir etwas danach brauchen. Früher sah man das über Kinder und Traditionen gegeben. Das ist längst zweifelhaft geworden. Aber für Künstler/innen stellte sich das immer anders dar: Sie spekulierten immer darauf, über die eigenen Schöpfungen und die daraus geschöpfte Geschichte zu überleben, sich aus der Sphäre des Privaten in die Sphäre der kollektiven Geschichte einzufädeln.
Mit einer offensichtlich gebrochenen, sprunghaften Geschichte oder mit einfach stinklangweiliger Nachgeschichte wird das schwer. Der Zweifel ist berechtigt: Wie und warum soll man das überliefern? Dagegen ist es eben immer noch einfacher, einen klaren Mythos zu schaffen, an dem man selbst und andere ordentlich arbeiten können. Deshalb leben mythische Gestalten, auch wenn sie noch so dumm oder ignorant waren, so viel länger als schräge, gebrochene und nachdenkliche Existenzen, die aus sich keinen Mythos machen wollten.
Nun, aber etwas zu erzählen haben, muss man wohl doch....
C: Ich muss zugeben, dass ich selbst lange auf meine eigene Geschichte hereingefallen bin, nämlich keine Geschichte erzählen oder schreiben zu wollen. Dafür stehen die relative Unsichtbarkeit meiner Arbeit und ihre schwere Zugänglichkeit. Parallel dazu habe ich aber sehr wohl auch an einem (meinem) Mythos gestrickt. Die Hackerin, die Cyberfeministin, die Aktivistin und Interventionistin... Das sind alles Einzelgeschichten, die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben, außer, dass sie irgend etwas mit mir zu tun haben. Und ein nicht unwesentlicher Teil dieser Geschichten ist einfach erfunden von mir und von anderen.
U: Du strickst also nicht an einem Mythos, sondern an ganz verschiedenen, springst immer in neue Rollen. Vielleicht könnte man aber auch sagen: Du arbeitest am Mythos der ungreifbaren und undurchdringlichen Frau, die sich stets wandelt, obwohl da auch einiges ist, was sich nicht wandelt;-). Und du lässt die anderen mitarbeiten... So habe ich vor einiger Zeit das Porträt "Cornelia Sollfrank" mit einem deiner Netzkunstgeneratoren erstellt. Es ist zugleich ein Fremd- und ein Selbstbild, hergestellt durch andere und eine Maschine bzw. ein Computerprogramm, aber nach deiner Maßgabe.
C: Ein wichtiges Moment ist das Zuschreiben oder Mitschreiben der anderen. Dazu ist es wichtig, dass die Geschichten Platz lassen für Interaktion oder Projektion.
U: Wie würdest du denn das in Beziehung setzen zu deinen lokalen Aktivitäten, z.B. mit der Mailingliste ECHO?
C: ECHO ist eine Liste für "Kunst - Kritik und Kulturpolitik in Hamburg". Sie dient in erster Linie zur Verbreitung von Nachrichten und Informationen und stellt dadurch eine Art virtueller Gemeinschaft her. Alle Leute, die da drauf sind (es sind zurzeit über 300) besitzen den gleichen Informationsstand, was für eine Diskussion und weitere Aktivitäten die Voraussetzung ist. Aber das ist nicht alles. Nur dadurch, dass die Liste als Informationsquelle glaubwürdig ist, ist es möglich, das Faktische gelegentlich mit Fiktivem anzureichern. Sie ist also auch hervorragend geeignet, um gezielte Falschmeldungen und Fakes zu platzieren, oder um einfach Gerüchte zu streuen. Dadurch ist es mehr als nur ein politisches Instrument der Aufklärung oder Gegenaufklärung. Genauso wie sich Gegenwart abbildet auf der Liste, erschafft sie diese auch.
U: Und welche Rolle spielst du als Person dabei?
C: Zum größten Teil bespiele ich die Liste, d.h. ich wähle aus, was drauf soll und was nicht. Darin spiegeln sich schon mal meine persönliche Wertung bzw. meine Vorlieben. Darüber hinaus stehe ich im Zentrum dieser virtuellen Gemeinschaft, für die ich Geschichten auswähle, aber eben manchmal auch selber schreibe oder erfinde. Und da bietet es sich auch an, meine eigene Geschichte mitzuschreiben. Aber es ist auch wichtig, dass es Geschichten sind, die andere mitschreiben können, oder dass sie darin vorkommen. Dadurch entsteht die Gemeinschaft, die dann auch wieder politisch funktioniert, d.h. als solche handlungsfähig wird.
Ich sehe darin einen Cross-over von Kunst und Politik, einen der funktioniert. Wichtig ist dabei auch, dass es sich zwar um eine virtuelle Gemeinschaft handelt, die aber Teil eines Ortes, einer Stadt, also lokal ist, d.h. die Handlungsfähigkeit entsteht dadurch, dass die Leute sich persönlich begegnen können. Die Liste hatte bisher schon wesentlichen Einfluss auf mein Leben und ich glaube, das ist für andere auch der Fall.
Es macht mir Spaß damit zu spielen, und ich sehe das Spiel in der Tradition des "Tricksters", also einer mythischen Figur, die ambivalent ist und schwer zu fassen, von Neugier, Lustgewinn und personalem Machtstreben motiviert ist und schöpferisch, aber auch gleichzeitig zerstörerisch ist. Und das wichtigste ist, dass gute Geschichten erzählt werden, vorzugsweise solche, die die Leute zum Lachen bringen:-)
U: Ich finde es interessant, wie sich Gegenwart in deiner Arbeit darstellt. Kunstwerke wurden ja früher immer gern von ihrer Entstehungszeit freigestellt, weil der Bezug auf eine soziale und politische Gegenwart als Wert mindernd galt, da mit einer Zeitwende eben auch das Kunstwerk wertlos, bzw. nur noch historisch interessant wäre. Das mag so sein, wenn die eigene Zeit eindimensional und positiv ins Werk gesetzt wird, was aber selbst bei Historienschinken nie so der Fall ist. Es würde ja wieder mal behaupten, dass Künstler/innen objektive Metainstanzen wären. Aber es gibt eben ganz andere Arten von Zeitbezug, die man als in die Zeit verstrickt, dabei schwebend, kontextbezogen und diskursiv bezeichnen kann. Solchen Zeitbezug findet man z.B. auch in den Arbeiten Anna Oppermanns. Bei dir ist die Bezugnahme noch einmal ausgeweitet, weil deine Arbeit nicht mehr ausschließlich auf das Kunstsystem ausgerichtet ist, sondern du in verschiedenen Medien und Öffentlichkeiten auftrittst und dich engagierst. Vielleicht liegt in dieser Beschreibung etwas, das für die Weitergabe gebrochener Biographien gilt: Sie schreiben sich an vielen Orten im Dialog mit anderen und überleben in der wiederholten Darstellung der Ereignisse und Zusammenhänge, der Knotenpunkte und Bruchstellen.
Veröffentlicht in: Theresa Georgen und Carola Muysers (Hrsg.), Bühnen des Selbst, Zur Autobiographie in den Künsten des 20. und 21. Jahrhunderts, Gestalt und Diskurs, Band IV, Muthesius Hochschule, Kiel, 2006