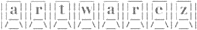Ein Künstlerinterview mit Cornelia Sollfrank von Felix Stalder.
Veröffentlicht in springerin, Winter 2015
Felix Stalder: Dein aktuelles Projekt „Giving What You Don't Have“ (GWYDH) kann als Fortsetzung deiner intensiven künstlerischen Beschäftigung mit dem
Urheberrecht im digitalen Kontext gelesen werden. Gleichzeitig markiert
es auch einen Wendepunkt. Stand in früheren Arbeiten eher im Zentrum, wie
unangemessen und oftmals hinderlich Urheberrecht in Bezug auf aktuelle
Praktiken ist, befasst du dich jetzt mit Projekten, die das Urheberrecht
weitestgehend ignorieren. Was hat dich zu diesem Perspektivenwechsel
veranlasst?
Cornelia Sollfrank: Im Rahmen meines practice-based PhD habe ich mich fünf Jahre lang mit dem Paradox beschäftigt, dass Urheberrecht einerseits künstlerisches Schaffen anregen und schützen soll, während es für alle Kunstformen, die auf bestehende Werke zurückgreifen – diese bearbeiten, verarbeiten, in irgend einer Form aneignen – mehr als hinderlich ist; es macht sie illegal bzw. befördert die Künstler_innen in eine juristische Grauzone, in der sie alle Risiken selbst tragen müssen. Diese Rechtsunsicherheit wirkt dann wieder zurück auf die ästhetische Praxis, wodurch Recht in die Entwicklung der Kunst regulierend und normierend eingreift.
Der Perspektivenwechsel kam mit der Erkenntnis, dass Künstler_innen in dem Diskurs um geistiges Eigentum zwar eine wichtige Rolle spielen – nicht zuletzt als Argumentationsfigur für die Interessen der Content-Industrien –, aber im Rahmen des informationellen Kapitalismus, bei dem es darum geht, Wissen, Bildung und Kultur vollständig zu ökonomisieren, sind die oben beschriebenen Probleme marginal. Zwar werden an diesem Problemen auch die systemimmanenten Widersprüche zwischen verschiedenen Businessmodellen deutlich – denjenigen, die Content vermarkten und denjenigen, die auf freien Content für den Betrieb ihrer Plattformen angewiesen sind – aber Künstler_innen als Opfer des Urheberrechts zu stilisieren bzw. für sie die Rolle der Superuser mit Sonderrechten zu beanspruchen, repräsentiert kein zeitgenössisch-kritisch-aufgeklärtes Kunstverständnis. Vielmehr begann mich die Frage zu interessieren, was Künstler_innen beitragen können zur Bewahrung und Produktion von gemeinschaftlich nutzbaren Gütern – den Commons.
Im Rahmen von GWYDH betreibe ich erst einmal eine Kartierung und Kontextualisierung solcher Projekte und versuche dabei, über einen Kunstbegriff nachzudenken, der sie verbinden könnte.
FS: Die Projekte, die du in GWYDH untersuchst, schaffen ja alle auf unterschiedlichste Weisen eigene Archive – oftmals marginale kulturelle Ressourcen. Was verbindet und was trennt diese Projekte?
C.S.: Wie sich aus dem Titel herauslesen lässt, geht es mir im Wesentlichen um Projekte, die ein Stück Infrastruktur, ein Tool oder eine Art Service anbieten, der kulturelle Güter zugänglich macht; also nicht um individuellen künstlerischen Ausdruck oder lediglich symbolhaft wirkende Projekte, sondern tatsächliche Öffnungen innerhalb bestehender (Distributions-)Systeme. In jedem Fall aber geht es um die freie Zirkulation von Wissen und Kultur, von der nicht nur die einzelnen Künstler selbst profitieren – wie es z.B. für die Appropriation art typisch war –, sondern die gesamte Öffentlichkeit. Die Spannbreite ist groß und reicht von Archiven und Repositorien bis hin zu digitalen Tools und diversen Formen der Wissensvermittlung – Handbücher oder Formate für selbst-organisiertes Lernen, wie Workshops, freie Schulen etc. Internet-Plattformen spielen dabei für Organisierung und Kommunikation eine wichtige Rolle und ein kritischer Umgang mit digitalen Technologien ist die Grundlage. Jüngste Überlegungen gehen sogar in die Richtung auch nicht-digitale Commons mit einzubeziehen.
Was die Projekte gemeinsam haben, ist dass sie in ihrer Zweckmäßigkeit Kritik üben an bestehenden Verhältnissen. Sie stellen etwas bereit, was fehlt in der Gesellschaft – und was aus juristischen oder ökonomischen Gründen an keinem anderen Ort als den der Kunst stattfinden kann.
FS: Da stellt sich die Frage: Ist das denn Kunst, oder wird hier die Grenze zur Dienstleistung überschritten?
C.S.: Kunst ist eine diskursive Konstruktion! Eine Grenzziehung zwischen Kunst und Nicht-Kunst zu machen, ist das Geschäft der Kunsttheorien. Seitdem Kunst mehr als Imitation ist, war immer Theorie notwendig, um den Kunststatus eines Werkes zu begründen. Das heißt, um neue Kunstformen zu ermöglichen, braucht es eine Erweiterung oder Verschiebung der Parameter des Diskurses bei gleichzeitiger Bezugnahme auf bekannte Theorien und Geschichtsschreibungen – bei deren gleichzeitiger Überschreitung natürlich. Damit wird die Frage, ob etwas Kunst ist oder nicht hinfällig, und man sollte sie lieber produktiv wenden und fragen, ‚wer’ definiert, was Kunst ist/sein soll und in welchem Interesse! ‚Wer’ ermächtigt sich, derartige Ein- und Ausschlüsse zu produzieren?
Künstler_innen machen vielfach die praktischen Angebote; sie bringen Subjektivität und Gesellschaft immer wieder auf neue und ungekannte Weise in Zusammenhang und irritieren damit das traditionelle und etablierte Verständnis von ‚ästhetischer Formgebung’ mit ihrem Kunstanspruch. Aber nur wenn ihr Tun auch eine Anbindung an den Kunstdiskurs herstellt, haben sie eine Chance, dass aus diesem ‚Anderen’ auch Kunst wird. Das mag ein Grund dafür sein, dass gerade die Künstler_innen, die an neuen Kunstformen arbeiten sich oft auch für Kunsttheorie interessieren; sie wollen die Definitionsmacht nicht anderen überlassen. GWYDH sehe ich in dieser Tradition. Es ist ein künstlerischer Versuch, neue Formen von Kunst zu identifizieren und in Zusammenhang zu stellen und Kunstautonomie im Angesicht der Kreativindustrien und vollständiger Ökonomisierung der Kultur neu zu denken.
FS: Wenn wir deinem Argument folgen, dass es sich hier um künstlerische Projekte handelt, dann drängt sich die Frage nach der ästhetischen Dimension auf. Wo würdest du diese verorten?
C.S.: Das ist eine zentrale Frage des Projektes, aber ich maße mir nicht an, diese allein zu beantworten. Vielmehr suche ich als Teil des Projektes die Auseinandersetzung mit Kolleg_innen. Und das ist auch bezeichnend für die Projekte von GWYDH; sie bieten nämlich nicht nur einen nützlichen Service an, sondern kreieren auch einen Diskurs um die jeweiligen Themen – Marcell Mars z.B. wenn er überprüft, wie sich die Idee der öffentlichen Bibliothek im digitalen Zeitalter verändert hat und Vorschläge macht für eine zeitgemäße Version. Die Projekte haben also zwei Aspekte: einen zweck-orientierten, praktischen und einen diskursiv-symbolischen. Das kann man in jedem Fall als Ausgangspunkt nehmen, will man über die ästhetischen Dimension nachdenken.
Den Begriff der Autonomie finde ich in diesem Zusammenhang auch wichtig, denn die Künstler_innen handeln im Selbstauftrag. Aber im Gegensatz zum klassischen Genie handeln sie mit dem Anspruch gesellschaftlich wirksam zu werden. Damit werden sie zu rebellischen Subjekten, die nicht im Eigeninteresse handeln, sondern im Interesse weiter Teile der Gesellschaft. Damit muss die Rolle der Kunst in der Gesellschaft genauer bestimmt werden, wofür sich auch Bezugnahmen auf gewisse idealistische Werte anbieten. Für dieses ganze, noch etwas unausgereifte Unterfangen habe ich den Begriff ‚Post-IP Aesthetics’ vorgeschlagen. Er macht deutlich, dass eine historische Bezugnahme wichtig ist, andererseits indiziert er aber auch einen Bruch mit der traditionellen Ästhetik – mit dem nicht selten auch herrschende Rechtsnormen überschritten werden. In den Projekten, die ich damit verbinde, sehe aber nicht nur eine Kritik, sondern auch das Aufzeigen einer Utopie, einen konkreten Vorschlag, wie es anders sein könnte. Das könnte ein weiterer Aspekt sein in der Diskussion um die ästhetische Dimension.
Wichtige Referenzen sind für mich die historische Avantgarde im post-revolutionären Russland oder die post-marxistische Ästhetik. Marcuse ist anregend, da er in seinem Essay ‚Die Permanenz der Kunst’ (1977) die Autonomie der Kunst gerade in ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft begründet. Mir gefällt diese Ambivalenz eines Kunstbegriffs, der einerseits notwendig angewiesen ist auf ein Ausgenommensein aus den gesellschaftlichen Verhältnissen und andererseits beansprucht, auf diese einwirken zu wollen.
Sich die Freiheit zu nehmen – die bei den Projekten von GWYDH gerade in der Transgression bestehender Normen liegt – transzendiert die Verhältnisse, zumindest in einem kleinen Bereich. Die Projekte können somit Vorbildcharakter beanspruchen. Sie liefern anschauliche Entwürfe und wirken als Verstärker und Verbreiter neuer Normen, die erst noch Recht werden müssen. Durch ihr freies Handeln praktizieren die Künstler_innen nicht nur ein verändertes Kunstverständnis; sie schaffen auch ein neues Verhältnis zur Realität und damit neue Realitäten.
FS: Deine Arbeit findet zu einem großen Teil in akademischen Zusammenhängen statt; formal besteht GWYDH aus einer Serie von Interviews. Als was siehst du deine Arbeit: künstlerische Forschung? Soll man so etwas von „normaler“ künstlerischer Arbeit abgrenzen?
C.S.: Ich tue das, was ich tue als Künstlerin und ich denke, es ist ein Hybrid zwischen Wissenschaft und Kunst. Formal könnten Wissenschaftler das auch tun, was ich mache, Interviews führen, schreiben, Workshops organisieren, lehren, aber die Perspektive, die ich habe und die Fragestellungen, die mir wichtig sind, sind künstlerische; kein Wissenschaftler forscht in dem Bereich, den ich für meine Forschung definiert habe. Außerdem kann ich als Künstlerin viel freier mit meinen Methoden umgehen oder der Präsentation meiner Ergebnisse. Künstlerische Forschung kann dafür ein hilfreicher Begriff sein, wenn man darunter versteht, Künstler_innen den Freiraum einzuräumen, nicht unmittelbar Ausstellungskunst oder Stadtmöblierung produzieren zu müssen oder zu Stadtmarketing und Eventkultur beizutragen zu müssen. Es kann temporär ein Freiraum sein für die Erweiterung des Kunstbegriffs – aber die Ökonomisierungs- und Verwertungslogik wird davor auch nicht halt machen.
Projektseite: http://artwarez.org/projects/GWYDH