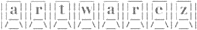Das Bewusstsein bestimmt das Sein – oder warum man administrative Vorgaben nicht zu ernst nehmen sollte
Interview mit Martin Köttering, dem Präsidenten der Hamburger Hochschule für bildende Künste.
In einem Gespräch mit einem Vertreter der Hamburger Wissenschaftsbehörde, Dr. Holger Tiedemann, „Ausnahmsweise Freie Kunst“ wurden bereits die administrativen Vorgaben der Bologna-Richtlinien erörtert; ein Studierender der Hochschule für bildende Künste Hamburg, Frank Wörler, machte mit seinem Text „Angeblich Freie Kunst“ darauf eine Replik. Nun kommt Martin Köttering, Präsident der HFBK zu Wort. In einem weiteren Gespräch, das Cornelia Sollfrank für THE THING Hamburg führte, erläutert er, warum sich die Hochschule für die Umstellung auf das Bachlor-Master-Studiensystem entschieden hat und wie das künftig die Lehre verändern wird. Die erste Textfassung wurde per Mail ergänzt und verändert.
15. August 2008
Erstveröffentlicht bei: http://thing-hamburg.de/index.php?id=930
Zur Person
C.S.: Wie lange sind Sie inzwischen Präsident der HFBK?
[Martin Köttering]
Seit Juli 2002, also seit etwa sechs Jahren.
[Cornelia Sollfrank]
Was ist Ihr persönlicher Hintergrund?
M.K.: Ich habe Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis studiert, war für ein Jahr in England, wo ich Bildende Kunst studierte. Mit einer Assistenz bei Jan Hoet und der documenta 9 ging’s weiter. 1995 habe ich die Leitung der Städtischen Galerie in Nordhorn übernommen und darüber hinaus das Kunst-im-öffentlichen-Raum-Projekt „kunstwegen“ sowie einige Projekte für das Ministerium in Niedersachsen realisiert.
C.S.: Was hat Sie dazu bewogen, von der kuratorischen Praxis kommend, sich für die Präsidentschaft der HFBK zu bewerben? Was hat Sie daran besonders interessiert?
M.K.: Franz Erhard Walther, mit dem ich damals ein großes Projekt realisierte, machte mich auf die Ausschreibung aufmerksam. Ohne seinen Hinweis wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, mich zu bewerben. Im Grunde hat mir meine Arbeit als Kurator nämlich sehr gut gefallen. Dort konnte ich für die Kunst und die Künstler tatsächlich etwas „ermöglichen“. Die Vorstellung, das auch als Hochschulpräsident tun zu können, brachte mich dann aber dazu, mich auf diese Stelle zu bewerben – und nicht zuletzt der Wunsch, der ganz jungen Kunst näher zu sein.
Alles ist Bildende Kunst
C.S.: Wie wir inzwischen wissen, wurden in Hamburg die Kunsthochschulen nicht von der Einführung von Bachelor und Master ausgenommen – wie es etwa in NRW der Fall ist. Darüber hinaus gelten Sie persönlich nach anfänglicher Kritik inzwischen als Befürworter der Bologna-Reform.
M.K.: Ein einfaches Pro oder Contra „Bologna“ vereinfacht die Dinge unzulässig. Lassen Sie mich das deshalb etwas differenzieren. Ein Beschluss der Kultusministerkonferenz sah vor, dass Studiengänge der Freien Kunst bzw. künstlerische Studiengänge von der Bologna-Reform ausgenommen werden können. Darauf haben sich 90% der Bundesländer auch eingelassen und die so genannte „Freie Kunst“ aus dem Bologna-Prozess ausgeklammert. Das wäre wohl – mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit – auch in Hamburg möglich gewesen. Allerdings muss ich in Erinnerung rufen, dass sich die HFBK bereits in einem Reformprozess befand, als ich mein Amt antrat. Daran anknüpfend, hatten wir schon im Jahr 2003 einen Struktur- und Entwicklungsplan veröffentlicht. Der sah beispielsweise vor, das Studium unter dem Aspekt der Interdisziplinarität neu zu organisieren. Ich habe dazu Klausurtagungen initiiert, an denen Professoren, akademischer Mittelbau, der Hochschulsenat und Vertreter der Studierenden teilnahmen. Und als es dann um die Frage ging, ob in der Freien Kunst die Bachelor-Master-Struktur eingeführt werden solle, wurde das ebenso auf mehreren Klausurtagungen diskutiert. Wir sind gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, dass es für die HFBK keinesfalls ein guter Weg wäre, die Freie Kunst aus dem Bologna-Prozess herauszunehmen. Das hatte einen präzisen Grund. In jedem Fall wären wir nämlich gezwungen gewesen, das neue System zumindest in den Studiengängen Architektur, Industriedesign und Visuelle Kommunikation einzuführen. Allein die Freie Kunst davon auszunehmen, hätte die Hochschule aber gespalten oder sogar zerrissen. Als die Architektur dann aus der HFBK ausgegliedert wurde, wussten wir, dass wir uns definitiv gegen jede weitere Aufspaltung zu entscheiden hatten. Deshalb musste ich überlegen, wie eine Umstellung aller Fächer auf Bachelor und Master aussehen könnte. Dabei stellte sich heraus, dass ein Modell möglich war, das vier Jahre Bachelor und zwei Jahre Master vorsieht. Insgesamt dauert die Ausbildung damit sechs Jahre, was für die künstlerische Entwicklung auch notwendig ist. Die ersten vier BA-Jahre stellen ein Minimum dar, um eine eigene Position zu formulieren. Und die zwei Master-Jahre sind für KünstlerInnen wichtig, die ein künstlerisches Entwicklungsvorhaben „forschend“ vertiefen möchten. Noch entscheidender aber war für uns, dass die Studiengänge auf diesem Weg zusammengehalten werden konnten. Der interdisziplinäre Aspekt wurde somit nicht nur ausgebaut, sondern in der Hochschule strukturell verankert. Alle Disziplinen konnten nun als „künstlerische Fächer“ positioniert werden.
C.S.: Dann stimmt es also, dass alle Studiengänge an der HFBK jetzt unter Freier Kunst subsumiert sind?
M.K.: Ja, aber der neue BA-/MA-Studiengang heißt „Bildende Künste“.
C.S.: Und damit gelten alle definierten Ausnahmeregelungen: längere Studienzeit, weniger Module, eigenes Profil, eigener Abschluss für alle Studiengänge. Das ist ein interessanter Schritt, der für die Visuelle Kommunikation vielleicht noch näher lag als z.B. beim Industriedesign.
War das eine taktische Entscheidung, alle vorherigen Studiengänge zu Bildender Kunst zu erklären, damit für alle die gleichen bürokratischen Vorgaben, sprich größere Freiheiten gelten können? War es ein Trick auf formaler Ebene? Oder verbirgt sich hinter dieser Entscheidung ein inhaltlicher Wunsch, die Ausrichtung und das Profil der Schule in Richtung Bildende Künste zu verschieben?
M.K.: Man kann die beiden Ansätze nicht ganz voneinander trennen. Zum Teil reagiert man auf Vorgaben des Ministeriums, zum Teil geht es um inhaltliche Fragen. Letztere haben, wie ich meine, überwogen. Es gab viele Gespräche nicht nur auf den Klausurtagungen, nicht nur in den Studiengangs- und Hochschulsenatssitzungen. Es gab Gespräche zwischen Lehrenden und Studierenden. In denen ging es, zumindest für mich, immer darum zu klären: Was für eine Hochschule wollen wir, und wie kann die Entwicklung in die Richtung “Bildende Künste” gehen? Wir wollen, dass die Hochschule interdisziplinär funktioniert und alle Lehrenden und Werkstätten für das individuelle Entwicklungsvorhaben eines jeden Studierenden zur Verfügung stehen. Das war bei allem maßgebend. Ein Studierender, der hier anfängt, soll möglichst viele Optionen haben, eine eigene künstlerische Position zu entwickeln. Deshalb war auch klar, dass wir die Studiengänge nicht auseinanderreißen können. Wir müssen sie viel eher zusammenführen. Gleichzeitig war klar, dass alle ProfessorInnen in der Lehrform der Einzelkorrektur einen individuellen Unterricht anbieten und die Studierenden als Mentoren dabei unterstützen, ihren eigenen künstlerischen Weg zu gehen.
Bologna
C.S.: Es ist bekannt, dass Sie ursprünglich der Bologna-Reform gegenüber kritisch waren. Was veranlasste Sie dazu, ihre Meinung zu revidieren?
M.K.: Ich habe festgestellt, dass die so genannte Systemdominanz des Bachelor-Master-Systems nicht so groß ist, wie das immer dargestellt wird. Und ich sehe großen Vorteil in der Zweistufigkeit des Systems. Mit dem Master kann man tatsächlich einen Forschungsschwerpunkt setzen, an dem man noch einmal zwei Jahre lang ganz intensiv arbeitet. Das ist eine Struktur, der man durchaus etwas Positives abgewinnen kann.
C.S.: Würden Sie bitte nochmal die Gründe ihrer anfänglichen Vorbehalte gegen Bologna ausführen?
M.K.: Die wesentlichen Vorbehalte lassen sich festmachen an Formulierungen wie „Modulen“ oder „Credit Points“.
C.S.: Das heißt die Terminologie der Wirtschaftlichkeit, der Effizienz, der Messbarkeit, der Evaluierung etc.?
M.K: Was einem von dieser Terminologie versprochen wird, ist tatsächlich eine Farce – das muss man ganz deutlich sagen. In der Kunstausbildung ist es eine Farce zu sagen, du machst hier ein Modul und das wird dann woanders anerkannt, und erleichtert insofern die internationale Mobilität: Völliger Blödsinn! Nach wie vor nehmen wir hier Studierende und Gaststudenten auf, nachdem wir uns deren Mappe angesehen haben. Da fragt keiner nach Modulen. Umgekehrt haben wir die Erfahrung gemacht, dass unsere Studierenden mit einem traditionellen Diplom auch in England oder den USA für ein Gastsemester angenommen wurden.
C.S.: Eigentlich ist die Idee der Reform ja auch gerade eine internationale Harmonisierung, so dass es problemlos möglich ist, mit einem Bachelor aus Frankreich in Deutschland einen Master zu machen, oder mit einem Master aus Deutschland in England ein PhD …
M.K.: Diese Idee gilt sicher für viele Fächer und Disziplinen. Aber in der künstlerischen Ausbildung bleibt davon praktisch nicht viel übrig. Dazu ist das Kunststudium nämlich viel zu individualisiert und „eigensinnig“. Tatsächlich wird der jeweilige Studienverlauf vom Studierenden selbst gewählt und bestimmt. Er entspricht völlig unterschiedlichen Fragestellungen und künstlerischen Entwicklungsvorhaben. Auch in Zukunft werden wir deshalb nur Studierende bei uns aufnehmen, von deren künstlerischer Leistung wir überzeugt sind – und nicht diejenigen, die ausreichend Credit Points gesammelt haben.
C.S.: Trotzdem gilt umgekehrt, dass Studierende der HFBK nur mit einem entsprechenden Abschluss im Ausland weiterstudieren können.
M.K.: Nein, wie ich bereits erläuterte, haben wir andere Erfahrungen gemacht.
Credit Points stören nicht
C.S.: Was sind weitere Gründe, aus denen Sie ursprünglich gegen Bologna waren?
M.K.: Die Modularisierung, das Herunterbrechen in kleine Lerneinheiten eines so genannten „Ausbildungsstudienganges“. Das halte ich in der künstlerischen Ausbildung für unmöglich. Man kann doch nicht einen künstlerischen Prozess modularisieren, denn er hat eine individuelle und keineswegs formalisierbare Dynamik. Inzwischen aber halte ich das unter bestimmten Umständen doch für möglich…
Die Credit Points waren der andere Grund. Tatsächlich hatte ich lange Zeit nicht verstanden, was das eigentlich ist – und wie ich festgestellt habe, ist das bei den meisten der Fall, die dagegen sind. Credit Points sind nämlich keine Sammelpunkte, wie diese Payback-Punkte der Tankstellen oder Drogerieketten…
C.S.: Dummerweise ist es aber genau das, was das Wort bezeichnet… Was ist es denn, wenn nicht „Punkte gegen Leistung“?
M.K.: Man kann einen künstlerischen Prozess nicht in kleine Einheiten aufteilen, die dann belohnt werden. Beispielsweise kann man kein Bild malen, um dann zehn Punkte dafür zu bekommen. Das ist für künstlerische Prozesse nicht relevant und auch nicht so gemeint. Es ist nichts weiter als der bürokratische Versuch, ein Studium innerhalb einer bestimmten Zeit studierbar zu machen – ausgehend von einer 40-Stunden-Woche. Credit Points spiegeln eine Art Zeiteinheit wider, auch Workload genannt, die die aufzuwendende Lehr- und Lernzeit beschreiben bzw. kalkulierbar und transparent machen sollen.
C.S.: Und das erachten Sie für eine Kunsthochschule als ein hilfreiches Instrument?
M.K.: Ganz und gar nicht. Welcher Künstler hat eine 40-Stunden-Woche? Mancher leistet in zehn Stunden unglaublich viel, ein anderer kommt in 80 Stunden nicht dahin, wo er hinkommen möchte. Künstler zu sein ist eben weniger ein „Beruf“ als eine „Berufung“. Und die kann man schlecht auf eine bestimmte Stundenanzahl umlegen. Seitdem ich aber – mit vielen anderen in der Hochschule – festellen konnte, dass diese Punkte, die das Bachelor-Master-System so maßgeblich prägen, für uns eigentlich irrelevant sind, stören sie mich auch nicht mehr. Zwar müssen wir sie definieren und beschreiben, aber das ist ein reiner Verwaltungsvorgang. Im Diplomsystem war z.B. die Definition des CNW (Curiculare Normwerte) eine dominierende „Währung“. Davon haben die Studierenden schon damals nichts mitbekommen. Gewiss, würde man alle formalen Vorgaben des Bachelor-Master-Systems in den Vordergrund rücken, so wäre ich auch heute noch ein Gegner dieses Systems. Betrachtet man sie aber als rein administrative Vorgaben und konzentriert sich auf die inhaltlichen Fragen, dann kann man mit diesem System ganz gut leben. Tatsächlich sind die inhaltlichen Fragen eines künstlerischen Studiums nämlich völlig unabhängig vom Studiensystem. Was wir gemacht haben, hätten wir auch mit dem Diplomstudiengang machen können. Oder wir hätten uns ein völlig neues System ausdenken können…
Das Sein bestimmt das Bewusstsein
C.S.: Sicher gibt es verschiedene Möglichkeiten mit den formalen Aspekten eines Systems umzugehen. Doch wenn das System einmal da ist, besteht keine Kontrolle mehr darüber, wer es in welcher Weise interpretiert. Sie sagen jetzt, wir sind da großzügig, Punkte, Module, nehmen wir nicht so genau. Ihr Nachfolger sieht das womöglich ganz anders.
Gleichzeitig ist dieses Bachelor-Master-System so ausdifferenziert, dass es völlig absurd wäre, erst die ganze Arbeit in die Ausdifferenzierung und Beschreibung zu stecken, um hinterher zu sagen, ist doch alles nicht so wichtig. An dieser Stelle entsteht ein unübersehbarer Widerspruch zwischen dem, was (von Ihnen) gesagt wird und dem, was getan wird. Ich glaube, Studierende, die sich gegen das System wehren, glauben nicht dem, was Sie sagen, sondern nehmen das ernst, was sie wahrnehmen durch die differenzierte Formalisierung, Stichwort 7200 Stunden Studierleistung, 40-Stunden-Woche. Das wird ernst genommen, und sie gehen nicht davon aus, wie Sie gerade versuchen klar zu machen, dass all das, womit man sich soviel Arbeit gemacht hat, keine Bedeutung hat.
M.K.: Ich sage überhaupt nicht, dass all das keine Bedeutung hat. Viele Aspekte, die wir ausdifferenziert und beschrieben haben, sind sehr bedeutend. Sehen Sie sich die Studiengangs- und -schwerpunktsbeschreibungen auf unserer Homepage an (www.hfbk-hamburg.de). Dort schaffen wir Klarheit über unsere Ziele, und wir stellen dar, wie wir diese Ziele erreichen wollen. Wenn Sie dagegen nach technokratischen Rahmenbedingungen fragen, die haben aus unserer Sicht keine wesentliche Bedeutung. Sie sollten überhaupt keinen Einfluss auf die Inhalte und Fragestellungen eines Kunststudiums haben. Von Bedeutung sind sie jedoch für die Organisation der staatlichen Institution Kunsthochschule, z.B. für das Verhältnis, wie viele Studierende von einem Lehrenden betreut werden können. Unschwer kann man das auch an der Realität von CNWs (Curriculare NormWerte) im Diplomstudiengang erkennen.
C.S.: Also, wer entscheidet das jetzt, wie ernst so eine klar vorhandene und genau definierte Struktur genommen werden muss? Entscheiden Sie das?
M.K.: Nein. Alles wichtige über die Entscheidungsstrukturen ist im Hochschulgesetz nachzulesen… Zwar gibt es eine stärkere Autonomie der Hochschule und auch erweiterte Entscheidungsmöglichkeiten des gesamten Präsidiums – aber das heißt ja auch: niemals des Präsidenten allein. Vor allem bleiben Entscheidungen, die den Studiengang betreffen, Entscheidungen des Hochschulsenats, ebenso formal wie inhaltlich. Im Hochschulsenat sitzen nicht nur ProfessorInnen und akademischer Mittelbau, sondern auch Studierende. Da werden also keine Entscheidungen eines Präsidenten gefällt und schon gar nicht die eines Senators abgenickt. Ebenso wenig sind es Entscheidungen einer Akkreditierungsagentur. Eine Akkreditierungsagentur prüft schließlich nicht Inhalte, sondern einzig die Studierbarkeit der Studienziele, ihre Schlüssigkeit und Kohärenz. Und sie will wissen, ob die personellen und finanziellen Ressourcen genügen, um die so formulierten Ziele zu erreichen. Das war bei den Diplomstudiengängen im übrigen nicht anders. Wer hat denn damals über die Vorgaben, Ordnungen und Satzungen etc. entschieden? Der Hochschulsenat!
C.S.: Können wir nochmal zu den Vorbehalten zurückkommen? Sie haben bereits einige formuliert und warum Sie diese dann wieder zurückgenommen haben. Gab es noch andere?
M.K.: Ein wesentlicher Vorbehalt war der Kontrollwahn, der mit dem Bachelor-Master-System assoziiert wird. Wenn ich meine Meinung darüber relativiert und korrigiert habe, so weil die entscheidende Frage meines Erachtens tatsächlich nicht das „System“ ist. Eine „Systemdominanz“ gibt es deshalb nicht, weil es der Senat selbst ist, der entscheidet. Die Betroffenen, Lehrende und Studierende, bestimmen über Studieninhalt und -verlauf. Insofern sind die Hochschulen tatsächlich autonom, ganz anders als etwa die Schulen, bei denen die Ministerien die Lehrpläne festlegen. Die Hochschule dagegen – und zwar Professoren wie Studierende – entscheidet auch über Modularisierungen und Studienordnungen. Und deshalb diskutieren wir vor allem über inhaltliche Fragestellungen. Durch „Bologna“ ist natürlich ein sehr wichtiger Diskussionsprozess in Gang gekommen. Ohne „Bologna“ wäre in einer so trägen Institution sicher kein ausreichender Reformwille vorhanden gewesen. Diese Diskussionen sollten übrigens in regelmäßigen Abständen wiederholt werden, auch aus der Sicht von „Externen“. Deswegen sind Evaluierungen nicht grundsätzlich falsch. Wir haben die Form dieser Evaluierung in einer eigenen Satzung zur Qualitätssicherung selbst festgelegt, den vermuteten „Kontrollwahn“ also per Satzung in eine sinnvolle Regelung übertragen.
C.S.: Das neue Hochschulgesetz hat unter anderem zur Folge, dass die Hochschulen mehr Autonomie haben. Sie interpretieren das sehr positiv, in dem Sinn, dass die Hochschule die Form, die sie sich gibt, sehr frei interpretieren kann. Frau Angerer hatte große Bedenken diesbzüglich, auch, weil das Präsidium nun mehr Macht hat. Ein Punkt, der permanent für Unmut sorgt, ist die Undeutlichkeit der Entscheidungsstrukturen: Einmal heißt es, der Präsident, der Köttering entscheidet alles…
M.K.: … sagt man so?
C.S.: Selbstverständlich, HFBK = Köttering – in der öffentlichen Wahrnehmung. Und der Präsident sagt, die Gremien entscheiden alles… Ich weiss, es gibt den Senat, das Präsidium und einen Hochschulrat. Wer setzt diese Gremien ein und was sind ihre tatsächlichen Befugnisse?
M.K.: Auch das steht alles im Hochschulgesetz, das ich Ihnen jetzt nicht vorlesen möchte. Nur in Kurzfassung: Relevante Entscheidungen, besonders inhaltliche, die das Studium betreffen, Studien-, Prüfungs- und Immatrikulationsordnungen werden ausschließlich vom Hochschulsenat getroffen.
C.S.: Wer ist genau alles im Senat vertreten?
M.K.: Der Senat besteht aus 11 Personen – sechs ProfessorInnen, zwei aus dem akademischen Mittelbau, einer aus der Verwaltung, zwei Studierende.
C.S.: Und wie kommen diese Personen in den Senat?
M.K.: Sie werden gewählt, wie in einer Demokratie üblich, und zwar jeweils aus der eigenen Gruppe. Das Präsidium hat Vorschlagsrecht für die Tagesordnung und kann in Senatssitzungen natürlich auch Themen steuern, indem es Tagesordnungspunkte festlegt, vor allem aber durch Argumente. Die Entscheidugen werden letztlich vom Senat getroffen. Und der Hochschulrat nun, das andere wichtige Gremium, hat das Recht, strategische Entscheidungen zu treffen.
C.S.: Zum Beispiel?
M.K.: Die sehr relevante Frage etwa, ob man nun die Bologna-Reform einleitet oder nicht. Er hat aber kein Mitspracherecht darüber, wie Module, Schwerpunkte oder Studien- und Prüfungsordnungen inhaltlich gestaltet werden.
C.S.: Der Hochschulrat besteht aus fünf Personen?
M.K.: Nicht so schnell, Sie hatten ja gefragt. Was das Verhältnis von Hochschulrat, Präsidium und Hochschulsenat betrifft, werden alle relevanten Entscheidungen vom Senat getroffen. Das Präsidium, nicht etwa der Präsident allein, hat gewisse Möglichkeiten einzugreifen, zum Beispiel bei der Berufung eines Professors oder einer Professorin. Bekanntlich lag diese Entscheidung früher beim Ministerium. Die Berufungskommission und der Hochschulsenat hatten eine Dreierliste vorzulegen, und das Ministerium konnte dann einen von der Dreierliste auswählen, zumindest theoretisch. Praktisch wurde es zumeist der Kandidat, die Kandidatin auf Platz 1. Diese Entscheidung wurde jetzt auf das Präsidium verlagert. Grundsätzlich hat es aber auch hier der Liste zu folgen – und muss verdammt gute Gründe haben, wenn es das nicht tut.
C.S.: Und was macht der Rat genau?
M.K.: Beispielsweise schlägt er den Kandidaten für das Präsidentenamt vor. Er ergreift also die Initiative – der Senat muss den Kandidaten oder die Kandatin aber bestätigen. Wenn der Senat zu einem ablehnenden Votum kommt, muss eine andere Person vorgeschlagen werden. Ebenso entscheidet der Hochschulrat über den Wirtschaftsplan, nachdem das Präsidium dem Senat eine Verteilung der Mittel vorgeschlagen und der Senat Stellung dazu genommen hat. Erst dann also beschließt der Hochschulrat. Der Rat trifft auch strategische Entscheidungen – z.B. ob freie Stelle nachbesetzt werden oder nicht. Aber auch das kann der Rat nur mit einer Stellungnahme des Senats beschließen… Es besteht also ein enges gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Als wir zum Beispiel beschlossen haben, die Fachbereiche Visuelle Kommunikation, Freie Kunst und Design aufzulösen und in einem Studiengang Bildende Künste zusammenzuführen, war das eine Entscheidung des Hochschulrates – allerdings auf Vorschlag des Senats.
C.S.: Und was entscheiden Sie?
M.K.: Das frage ich mich manchmal auch… Aber im Ernst: Zweifellos befindet sich der Präsident in einer einflussreichen Position, weil er zwischen Senat und Hochschulrat vermittelt – und insofern auch steuert. Tatsächlich aber entscheidet das Präsidium, nur im Einzelfall der Präsident alleine, wenn er z.B. das Hausrecht ausübt. Er muss außerdem in akuten Fällen entscheiden. Er erarbeitet mit dem Kanzler die Wirtschaftspläne und hat im Präsidium die gewichtigste Stimme.
C.S.: Das Präsidium besteht aus drei Personen?
M.K.: Aus vier. Es gibt zwei Vize-PräsidentInnen und den Kanzler. In einer Patt-Situation hätte der Präsident alledings die entscheidende Stimme. Grundsätzlich aber denke ich, dass die Entscheidungskompetenzen des Präsidenten – also in diesem Fall meine – komplett überschätzt werden. Manchmal habe ich den Eindruck, das sei eher eine Projektion von Lehrenden und ebenso von Studierenden, die vielleicht ein wenig autoritätsfixiert sind…
C.S.: … kein Wunder, wenn sie sich mit Polizei und privatem Wachschutz hier in der Schule konfroniert sehen… Aber sollten diese Personalisierungen von Macht tatsächlich nur Projektionen sein, dann passiert so etwas in der Regal dann, wenn die Strukturen nicht transparent genug sind…
Hans-Joachim Lenger äußerte in einem Interview, das er mit Ihnen im Mai dieses Jahres führte, den Vorwurf, die Studierenden würden sich so lange nicht um Hochschulpolitik kümmern, bis es zu spät sei. Ist das aber nicht vielmehr Ausdruck des Fehlens eines politisches Bewusstsein und einer Diskussionskultur (an dieser Schule) im Allgemeinen? Wäre es nicht wünschenswert, eine Sensibilität dafür zu entwickeln, wie die Macht- und Entscheidungsstrukturen aussehen, innerhalb derer man sich bewegt? Wie soll man Kunst machen können, wenn man nicht darüber nachdenkt, wer definiert, was Kunst ist? Das müsste doch Teil der Ausbildung sein! Ebenso das Mitgestalten der Umgebung in der man lebt, in diesem Fall also der Hochschule. Inwieweit gehört es zum Selbstverständnis der Hochschule, das zu fördern, also auch zu demokratischen Prozesse zu erziehen? Ich würde das als eine eigene Qualität in der Ausbildung definieren. Vielleicht als neues Module “Grundkurs in Demokratie” und “Praxis in Meinungsbildung und -äußerung”. Warum keine Credit Points für gesprayte Parolen?
M.K.: Es wäre traurig, wenn wir unsere Studierenden erst zu demokratischen Prozessen „erziehen“ müssten und Grundkurse in Demokratie und Meinungsbildung verordnen müssten. Außerdem haben die Diskussionen über die Studiengebühren gezeigt, dass die Studierenden das ganz gut beherrschen. Und das Thema der „Definitionsmacht der Kunst“ ist natürlich permanenter Bestandteil in den Theorieseminaren wie auch in den einzelnen Klassen.
Als ich vor sechs Jahren hier angefangen habe, gab es an der HFBK keine Transparenz und Diskussionsfelder. Also haben wir beispielsweise den Newsletter initiiert. Der wird zwar nicht immer von allen geliebt, aber er ist das Medium, das an vielen Punkten für Transparenz sorgt. Das fängt an bei Informationen über Ausstellungen und Stipendienmöglichkeiten, betrifft aber ebenso Entscheidungsprozesse bei der Mittelverteilung, z.B. für Exkursionen, Förderungen etc. Viele Jurys innerhalb der Hochschule haben wir völlig neu eingesetzt. Darüber hinaus versuchen wir mit der Newsletter-Beilage, bestimmte Themen aufzugreifen und Diskussionen zu führen. Außerdem veröffentlichen wir ein Jahrbuch, in dem wir für eine größere Öffentlichkeit dokumentieren, was in der Hochschule gemacht wird. Und wie bereits erwähnt, veranstalten wir Klausurtagungen, um Rahmenbedingungen für eine intensive Auseinandersetzung zu schaffen. Wenn Studierende in der Aula zu einer Diskussion aufriefen, sah man da eher wenig Lehrende. Im Kontext einer Klausurtagung, für die man sich gegenseitig verpflichtet, sich drei Tage mit bestimmten Themen zu beschäftigen, ist das anders. Grundsätzlich haben wir also eine sehr entwickelte Diskussionskultur im Haus.
C.S.: Das stellt sich nach außen sicher nicht so dar. Die meiste Aufmerksamkeit bekam die HFBK durch die Poteste gegen die Studiengebühren, und das sah von außen äußerst ungut aus, auf jeden Fall nicht nach Diskussionskultur.
M.K.: Tatsächlich ist im Verlauf dieser Proteste so intensiv diskutiert worden wie sonst nur selten. Positionen und Leidenschaften trafen ebenso aufeinander wie Argumente und politische Gegensätze. Ich erlebte all das eher als eine Zuspitzung oder Präzisierung der notwendigen Diskussionen… das muss ja nicht immer bei einer Tasse Tee stattfinden. Andererseits will ich natürlich nicht verschweigen, dass es auch Diskussionsabbrüche und Blockaden gegeben hat. Aber daraus lässt sich ja lernen.
C.S.: Und jetzt hat jemand anders ein Machtwort gesprochen, der Gesetzgeber. Die Gesetzeslage hat sich inzwischen wieder einmal geändert: Die Studiengebühren sind gesenkt worden und können kreditiert werden. Wie hat sich der Konflikt innerhalb der HFBK weiterentwickelt?
M.K.: Wir hatten in meinem Büro ein Gespräch, an dem drei Studierende und die drei mit der Sache befassten Rechtsanwälte teilnahmen. In dieser Runde fanden wir einen Weg, der sich als tragfähig herausstellte. Im Oktober wurde ein entsprechender Vorschlag von der Mehrheit der Studierenden in einer Vollversammlung angenommen.
C.S.: Wie sieht dieser Kompromiss aus?
M.K.: Alle Studierenden, die in den letzten Semestern nicht gezahlt haben, bekommen diese Summe zinsfrei gestundet. Das sieht das Gesetz für die zurückliegenden Semester eigentlich nicht vor, das neue, ab WS 08/09 geltende Gesetz aber sehr wohl. Wir haben das Gesetz etwas weitergehend interpretiert. Das ging auf einen Vorschlag der Rechtsanwälte der Studierenden zurück, und wir haben das aufgegriffen. Ab Oktober kann man sich Studiengebühren sowieso zinsfrei stunden lassen.
C.S.: Da hat die Gesetzesänderung gerade noch dazu beigetragen, die Situation hier an der Hochschule zu entschärfen. Bis zur nächsten Legislaturperiode zumindest… Im Moment muss die Stadt ja einspringen, so dass der Hochschule die Gelder nicht verloren gehen. Dass das eine Dauerlösung sein wird, halte ich für fraglich.
M.K.: Die Mehrheit der Bundesländer immerhin hat keine Studiengebühren. Viele haben die Entscheidung über die Gebühren an die einzelnen Hochschulen delegiert. Die politische Konjunktur für Studiengebühren schätze ich im übrigen als rückläufig ein. Vielleicht werden sie längerfristig auch wieder ganz abgeschafft… ich persönlich habe ja nie verschwiegen, dass ich das begrüßen würde.
C.S. Betrachtet man die Entwicklung im internationalen Vergleich, muss man zugeben, dass die Deutschen in dieser Hinsicht Nachzügler sind und es längerfristig gar nicht ausbleiben kann, sich internationalen Standards anzupassen.
M.K.: Seltsam, Sie sind also tatsächlich für Studiengebühren?
C.S.: Ich bin davon überzeugt, dass die Hochschulen langfristig nicht darum herumkommen werden, die Entscheidung über Studiengebühren selbst zu treffen und auch die Konsquenzen ihrer Entscheidung zu tragen.
M.K.: Die Wissenschaftsminister wissen sehr genau, dass Studiengebühren wie in England oder Amerika zum Nachteil eines Bildungssystems ausschlagen. Das zeigen die Entwicklungen in diesen Ländern sehr deutlich. Dort überlegt man, wie man dies kompensieren kann, z.B. durch Stipendien etc. Aber insgesamt steht das Modell mit den Studiengebühren auf wackeligen Beinen. Und dies stimmt mich eher optimistisch. Neueste Untersuchungen z.B. von HIS geben mir da übrigens Recht.
C.S.: Davon ausgehend, dass die durchgeführten Reformen zur Verbesserung der Ausbildung in diesem Haus beitragen, was wird künftig besser sein?
M.K.: Das ist eine sehr gute Frage. Denn allzu oft hängen sich Diskussionen an Begriffen wie „Modul“ oder „Credit Points“ auf, ohne nach den zentralen Problemen zu fragen. Ausbildung im Kunstbereich kann nur gelingen, wenn sie sich darauf konzentriert, das Potenzial der Kunst freizulegen. Und die Hochschule hat sich darum zu bemühen, Bedingungen zu schaffen, in denen sich die künstlerischen Erfahrungsprozesse möglichst gut entfalten. Wenn sich alle Prüfungsordnungen, Studienordnungen und Studiengangssysteme von dieser Frage leiten lassen, dann ist die Kunst die stärkste Kraft, die man sich vorstellen kann. Lässt man sich davon leiten, ist man immer auf einem sinnvollen Weg.
Die Kunsthochschule als ein Reich der Optionen
C.S.: Wie sieht es nun mit der alten Klassenstruktur aus?
M.K.: Das ist nicht festgeschrieben. Festgeschrieben wurde nur, dass der Impuls des Studierens, dass Lehre und gemeinsame Arbeit immer von den Interessen und Ambitionen der Studierenden auszugehen haben.
C.S.: Ich möchte zum Beispiel bei Werner Büttner studieren.
M.K.: Dann bemühen sie sich darum, in seine Klasse zu kommen. Das ist eine Option.
C.S.: Die Klassenverbände gibt es also noch. Ich kenne das aus Hochschulen, z.B. Weimar, an denen es keine Klassen mehr gibt, dass das Fehlen sozialer Verbände durchaus problematisch sein kann.
M.K.: Wir haben ein offenes Klassensystem. Man kann sich also in das künstlerische Netzwerk einer Klasse begeben. Für viele Studierende ist das sinnvoll und hilfreich, weil sie ein festes soziales Gefüge brauchen, um sich entfalten zu können. Für andere überhaupt nicht, die sind heute bei Büttner und morgen bei Wenders.
Maßstabgebend ist immer, dass der Impuls vom Studierenden ausgeht. Und der Studierende auf seinem Weg die gesamte Hochschule mit allen ihren Ressourcen, personeller Art, da wo wir finanzielle Möglichkeiten haben und Werkstätten, alles nutzen können soll und zwar so, wie es ihm hilfreich ist. Und damit auch seinen Weg durch das Studium so gehen kann, dass er seine künstlerische Position entwickelt.
C.S.: Die Kunsthochschule ist also ein Reich von Optionen für Studierende?
M.K.: Wir versuchen, an der HFBK nicht ein System vorzugeben, von dem man glaubt, es würde die besten Künstler produzieren. Sondern wir versuchen, uns auf den Studierenden zu konzentrieren und ihm einen individuellen Weg zu eröffnen. Wenn jemand feste Strukturen braucht, kann er sie bekommen. Wenn jemand größtmögliche Freiheit braucht, kann er sie sich nehmen.
C.S.: Hamburg als Modell, das alle anderen Modelle einschließt?
M.K.: Nein, das HFBK-Modell konzentriert sich auf die künstlerischen Entwicklungsvorhaben der Studierenden und auf die dafür notwendigen Rahmenbedingungen. Im Gegensatz zu anderen Kunstakademien, besonders den sehr traditionellen, denken wir die Struktur nicht vom Professor als eines “Meisters”, sondern vom Studierenden aus.
Will man die Extrempositionen formulieren, also einerseits Düsseldorf als klassisches Akademie-Modell mit einem reinen Meister-Schüler-Verhältnis, dass dann leider oft zu einem Epigonentum führt, auf der anderen Seite z.B. die Bauhausuniversität Weimar, in der es keine Klassen mehr gibt. Alle diese Modelle sind einseitig und berücksichtigen nicht die individuellen Entwicklungswege der Studierenden.
C.S.: Aber ganz ohne Verbindlichkeiten ist das neue System nicht. Worin bestehen diese?
M.K.: Die gesamte Hochschule bietet eine Vielfalt an Optionen und Ressourcen für die Studierenden. Wir haben wenige Verbindlichkeiten formuliert: Wir erwarten natürlich, dass künstlerische Arbeiten entstehen, und diese müssen in jedem Semester durch Einzelkorrekturen begleitet werden. Darin besteht das Modul des „künstlerischen Entwicklungsvorhabens“, in dem Studierende bei ihrer künstlerischen Positionierung von ProfessorInnen mentoriert werden. Zusätzlich müssen sie mindestens einmal im Semester – und da geben wir sicherlich mehr Vorgaben als traditionelle Akademien – an einem Theorieseminar teilgenommen haben. Das sind die Pflichtvorgaben. Daneben gibt es noch die Wahlpflicht. Bei der kann man zwischen verschiedenen Optionen wählen, z.B. einer Gruppenkorrektur oder einem Werkstattkurs oder einem weiteren Theorieschein.
C.S.: Das wäre dann je nach Wahl das dritte Modul, das in einem Semester absolviert werden muss?
M.K.: Ja.
Lehr- und Lerninhalte
C.S.: Das neue System beginnt jetzt im Wintersemester. Wie viele Module sind denn bereits ausformuliert?
M.K.: Alle, zumindest vorläufig. Sie können sich je nach Diskussion und inhaltlichen Vorstellungen wieder ändern.
Wir sind mit dem Gedanken „Modul“ nicht davon ausgegangen, dass Bologna uns vorgibt, wie die Module formuliert sein müssen, sondern von dem, was wollen wir, inhaltlich. Was sind unsere Vorstellungen? Und wie kann man daraus die Beschreibung eines Moduls ableiten? Es mag sich für einen Fan des Bachelor-Master-Sytems merkwürdig anhören, aber jedes künstlerische Entwicklungsvorhaben zählt bei uns als eigenes Modul. Das bedeutet, die künstlerische Einzelkorrektur ist die so genannte Modulprüfung, egal bei wem ich sie mache. Die Professoren vertreten eine Disziplin und mentorieren die Studierenden bei der Entwicklung ihrer künstlerischen Haltung.
C.S.: Wie viele ProfessorInnen haben die Studierenden denn zur Auswahl?
M.K.: Wir haben, inklusive der Grafiker, Filmer und Designer, 42 KünstlerprofessorInnen, die frei wählbar sind, und sechs Theorie-ProfessorInnen, die das Modul wissenschaftliche Studien abdecken. Dazu kommen ca. 20 Werkstätten und die Gruppenkorrekturen, die ja auch von den KünstlerInnen gemacht werden.
C.S.: Anders herum gefragt, was gibt es jetzt inhaltlich wirklich Neues?
M.K.: Mit der neu entwickelten modular-interdisziplinären Studienstruktur steht jetzt das gesamte Angebot der Hochschule allen Studierenden offen. Sie haben die freie Wahl, ihr Studium an ihren singulären künstlerischen Frage- und Problemstellungen auszurichten und sich adäquate Medien für ihr spezifisches Vorhaben zu erschließen. Das war vorher, wenn überhaupt, nur inoffiziell und partiell möglich. Zugleich haben wir uns aus inhaltlichen Gründen für eine Erhöhung der Verbindlichkeiten entschieden: Waren früher zwei, respektive drei Scheine bis zum Vordiplom und danach noch einmal drei bis zum Diplom nötig, so muss man heute jedes Semester einen Theorie-Schein machen, eine Einzelkorrektur und ein drittes frei wählbares Modul belegen. Insofern haben wir tatsächlich eine Verbindlichkeit formuliert, die es vorher nicht gab.
C.S.: Das heißt, ein Semester kreatives Verschwinden aus der Hochschule gibt es nicht mehr?
M.K.: Doch, man nimmt dann ein Urlaubssemester. Oder man spricht es mit dem Professor ab; man erklärt ihm die Absicht, zu verschwinden und eventuell gegen Ende des Semesters wiederzukommen. Dann könnte man zeigen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Um es ein bisschen salopp zu formulieren: Wenn jemand tatsächlich in seiner eigenen künstlerischen Entwicklung die Notwendigkeit spürt, ein Semester aus dem Fenster zu schauen – warum sollte der Professor die Gedankenleistung, die da (möglicherweise) vollbracht wird, nicht mit der Unterschrift auf einem Schein bestätigen? Immerhin, diese Leistung muss sich natürlich irgendwo niederschlagen, und zwar auf überzeugende Weise. Künstlerische Prozesse lassen sich nicht formalisieren. Selbstverständlich könnte auch “das Verschwinden” als Leistung oder künstlerische Figur akzeptiert werden. Doch Sie wissen genauso gut wie ich, dass ein Loch als solches nicht erkennbar ist, wenn es nicht durch irgendetwas als „Loch“ markiert und zur Erscheinung gebracht wird.
C.S.: Wer genau hat die jetzt bestehenden Module beschrieben?
M.K.: Die ProfessorInnen haben die Studienschwerpunktsbeschreibungen formuliert. Aber noch wichtiger ist mir etwas anderes. Es müssen auch für künstlerische Studiengänge inhaltliche Vorgaben gesetzt werden: Die HFBK Hamburg will den Studierenden einen diskursiven Raum für ästhetische Erfahrungen und künstlerische Prozesse bieten, die von ProfessorInnen mentoriert werden. Wir „unterrichten“ also nicht, wir belehren nicht – wir mentorieren. Das ist unsere Hauptaufgabe. Der Prozess jedoch geht von dem Studierenden aus, von seinem Engagement, seiner Energie und seinen Ambitionen. Bologna-Ideen, die im Curriculum minuitiös den Werdegang von Studierenden vorgeben wollen, sind insofern verfehlt. Letztlich geht es darum, die Studierenden so zu fördern, dass sie ihren singulären Fragestellungen folgen können – und sich am Ende ihres Studiums eine eigenständige künstlerische Position erarbeitet haben.
C.S.: In welcher Form ist das Scheitern eingeplant, auch als Modul?
M.K.: Die angestrebte Studienpraxis basiert auf dem Experimentellen. Insofern begünstigt sie diskontinuierliche und auch unwägbare Entwicklungen. Wir verlangen am Ende eines Semesters nicht den Nachweis eines Erfolgs im herkömmlichen Sinne. Das Scheitern an einer Fragestellung kann ein viel größerer Erfolg sein. Primär geht es immer darum, die Prozesshaftigkeit ästhetischer Erfahrung zu reflektieren.
C.S.: Vielen Dank für das Gespräch.